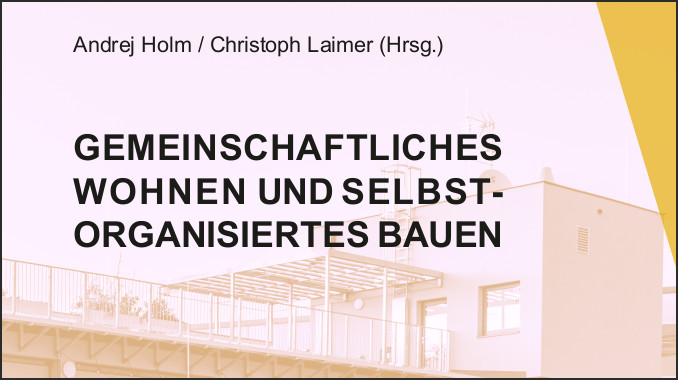Quelle: https://doi.org/10.34727/2021/isbn.978-3-85448-044-0_4. Dieser Beitrag wird unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 veröffentlicht. Erschienen in: Holm, A., & Laimer, C. (Eds.). (2021). Gemeinschaftliches Wohnen und selbstorganisiertes Bauen. TU Wien Academic Press. S. 43-53. https://doi.org/10.34727/2021/isbn.978-3-85448-044-0
Silke Helfrich, Tomislav Knaffl, Stefan Meretz
Commons statt Gemeinschaft
Anders bauen und wohnen
1. VON ADIS UND AMISCHEN
Wer das Video[1] schaut, reibt sich verwundert die Augen: Nach nur zehn Stunden steht dort, wo es vorher nur Grundmauern gab, eine riesige Doppelscheune. Am 13. Mai 2014 wurde sie von den Amish People[2] im Bundesstaat Ohio errichtet, verkleidet und gedeckt. Die Erinnerung an die Millionenmetropole Wuhan drängt sich auf. Dort ließ die chinesische Regierung Anfang Februar 2020 im Kampf gegen das Corona-Virus binnen zehn Tagen ein neues Krankenhaus aus dem Boden stampfen.[3] Im Gegensatz zu Wuhan kam jedoch in Ohio kaum mehr als Muskelkraft zum Einsatz. Im Video flimmern die dortigen zehn Stunden Bauzeit im Zeitraffer über den Bildschirm. Zu sehen sind drei Minuten und dreißig Sekunden Gewusel, in dem alles eine unfassbare Ordnung hat. Einer der beliebtesten Kommentare dazu lautet: „10 Stunden, um all das zu tun, und unser Stadtrat braucht 3 Jahre, um ein Schlagloch zu reparieren“. Darauf die nicht weniger beliebte Antwort: „Jeder Stadtrat braucht 3 Jahre und ein paar Millionen Dollar“. Tatsächlich scheint hinsichtlich der Effizienz einzig eine zentralistische und autoritäre Regierung den oft als vorgestrig belächelten Bauleuten der Doppelscheune das Wasser reichen zu können. Das ist bemerkenswert, doch es bemerkt fast niemand; vermutlich weil die Amische nach eigenen Aussagen „in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt“[4] sind.
Inspirierende Formen des Bauens gibt es allerdings nicht nur in den US-amerikanischen Siedlungen der Amischen, sondern auch in Europa, Afrika, Lateinamerika, Australien oder Indien – kurz: überall auf der Welt. In den Dörfern der Adis im nordostindischen Arunachal Pradesh haben sich über Jahrhunderte bemerkenswerte soziale Strukturen und Praktiken bewährt. Zu ihnen gehört das sogenannte Riglap. „Rig“ ist abgeleitet von „Arik“ und bedeutet „Feld“. „Lap“, die Kurzform von „Lapnam“, lässt sich übersetzen mit „um Hilfe bitten“. Das klingt zunächst, als ginge es nur um Hilfe bei der Feldarbeit, tatsächlich aber bezeichnet der Begriff eine Kultur der gegenseitigen Unterstützung, die immer dann zum Zuge kommt, wenn mehr als eine Person oder ein Haushalt nötig ist, um eine bestimmte Arbeit zu tun. Zum Beispiel Häuser, Scheunen oder Umfassungsmauern für die Felder bauen, um diese vor Überschwemmungen zu schützen (Mibang 2018).
Auch im Deutschland des 21. Jahrhunderts finden sich Menschen in Baugruppen oder Wohnprojekten zusammen, auch hier kennen wir das ,In-Bauangelegenheiten-um-Hilfe-bitten‘, wenn etwa Wohngemeinschaften oder Familien für konzertierte Aktionen sogenannte ,Bauwochen‘ ausschreiben. Wer Lust und Zeit hat, kommt, wird verköstigt, beherbergt und trägt bei, die Baustelle voranzubringen, die die jeweilige Kernbaugruppe allein überfordern würde. Eine solche Bauwoche ist keine ,Erbringung einer Dienstleistung‘, sie ist auch mehr als Hilfe beim Bau. Sie ist ein soziales und lehrreiches Event. Auf diesen Aspekt kommen wir später zurück. Bislang sollte deutlich geworden sein, dass die Autor*innen dieses Beitrags meinen, dass das Bauen mitgedacht werden muss, wenn wir über die Zukunft des Wohnens nachdenken. Zukunftsfähiges, commonsorientiertes Bauen und Wohnen gehören zusammen. Dabei soll – selbstredend – nicht einem gedankenlosen Kopieren von Strategien der Amischen oder der Adis das Wort geredet werden. Das wäre unsinnig, schließlich haben wir es überall und zu jedem Zeitpunkt mit spezifischen Herausforderungen, Kontexten und Größenordnungen zu tun. Doch wir können uns mit diesen Beispielen anderen Bauverständnissen nähern. Dabei geht es nicht darum, dass hier Gemeinschaften als Gemeinschaften bauen. Es geht auch nicht zwingend darum, dass sie für Gemeinschaften bauen. Es geht um ein anderes Verständnis des Bauprozesses an sich und damit um andere Rollenverständnisse aller Beteiligten. Kurz: um Commons statt Gemeinschaft. Wenn wir das Bauen auch als Commons verstehen, realisieren sich andere Interaktionsmodi, es wird anders geplant, finanziert und ausgeführt, und es kommen letztlich auch andere Materialien und Technologien (bestenfalls konviviale[5]) zum Einsatz. Am Vivihouse-Projekt, welches in diesem Band im Kapitel „Kollektiver Selbstbau als Testfeld für neue Produktionsweisen“ (S. 151–164) beschrieben wird, lässt sich dies gut zeigen.
2. EXKURS: COMMONS STATT GEMEINSCHAFTEN?
Commons sind weder eine definierbare Ressource, noch eine bestimmte (kollektive) Eigentumsform. Ebenso wenig bezeichnen sie einen bestimmten sozialen Akteur (etwa Gemeinschaften). Alles kann ein Commons werden, wenn Menschen ihre Bedürfnisse ernst nehmen und Wege finden, sie so zu befriedigen, dass alle einbezogen werden. Das selbstbestimmte gemeinsame Handeln, das Commoning, trifft dabei häufig auf den Commons entgegenstehende Bedingungen der Warengesellschaft, was immer wieder zur Reflexion der Organisations-, Kommunikations,- Rechts-, Produktionsformen zwingt, ähnlich wie wir das in diesem Artikel vornehmen.[6] Selbstredend gründen Commons wie auch Gemeinschaften auf etwas Gemeinsamem, doch diese Feststellung ist so unspezifisch wie Brief und Internet gleichermaßen als Kommunikationsmittel zu kennzeichnen. Schauen wir genauer hin.
Das Gemeinsame von – bloßen – Gemeinschaften gründet in Zwecken. Solche Zwecke sind einzeln schwerer zu erreichen als gemeinsam. Da sich Gemeinschaften im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext bewegen, agieren sie vor allem als Zweckbündnisse der Einzelnen. In unserer heutigen Gesellschaft ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass die Bedürfnisse von Menschen, zum Beispiel nach gutem Wohnraum, aufgehoben sind oder ihre Befriedigung tatsächlich vorrangiges Ziel der Gesellschaft ist. Die Privatmenschen müssen sich selbst darum kümmern. Sie tun dies, indem die „vereinzelten Einzelnen“, wie Marx (1974: 6) unsere Getrenntheit beschrieb, ihre Bedürfnisse als durchsetzungsfähige Interessen formieren, um ihnen Geltung zu verschaffen. Gemeinschaften, die Privat-Gemeinschaften sind und wiederum alle anderen ausschließen, sind ein Mittel dazu. Der Fokus solcher Gruppen sind die Interessen der beteiligten Einzelnen und nicht die der anderen Menschen oder gar der Gesellschaft. Ist der Gemeinschaftszweck erfüllt, fallen die Einzelnen häufig in ihren isolierten Status zurück.
Wenn Sie selbst zu einer Gemeinschaft gehören und jetzt das Gefühl haben, das trifft auf Ihre Gemeinschaft nicht (ganz so hart) zu, dann sind Sie vielleicht auf dem Weg zu einem Commons. Denn Commons sind mehr als äußerlich zusammengehaltene Zweckgemeinschaften. Es sind Lebensweisen oder besser: Sie können es werden. Denn Commons sind nicht, sie werden. Wie genau das geschieht und welche Qualität sie entfalten, hängt von den Beteiligten und ihren Bedürfnissen ab. Diese einzubeziehen, ist eine wesentliche Gelingensbedingung für die Stabilität von Commons. Vor allem bei Entscheidungen kommt das zum Tragen. Der Werdenscharakter wiederum macht Commons offen. Alles kann ein Commons werden, wenn wir es so behandeln, auch bloße Zweckgemeinschaften. Die Übergänge sind fließend. Doch das Fließen von Gemeinschaft zu Commons geschieht nicht einfach, sondern ist ein bewusster Prozess. Wie er aussehen kann, wollen wir im Folgenden für das Bauen und Wohnen zeigen.
3. BAUEN ALS COMMONS UNTER ERSCHWERTEN BEDINGUNGEN
Die Bedingungen für die Umsetzung dieser Perspektive – Bauen und Wohnen umfassend als Commons zu verstehen und zu praktizieren – sind alles andere als rosig.
- Überall auf der Welt, besonders im (semi-)urbanen Raum, dominiert eine Wirtschaftsweise, die in Waren und Warenproduktion denkt und danach handelt. Dieses Denken hat sich auch in unseren Köpfen eingenistet. Es geht von Fragen aus wie: Wo gibt es eine Marktlücke? Wem gelingt es, sie am schnellsten zu füllen? Statt immer wieder zu fragen: Wie schaffen wir selbstbestimmt und vor allem nachhaltig lebendige Wohnräume? Dieser Warenfokus lässt sich an ganz alltäglichen Dingen beobachten: am Angebot in Baumärkten – den Zulieferern des individuellen Selbstbaus – genauso wie am Lebenszyklus von Wohnraum (auf bauen – abwohnen – abreißen) oder im Design von Fertighäusern, die dem Durchschnittsgeschmack entsprechen müssen. Letzteres ist der Grund dafür, dass sich die Neubaugebiete um unsere Klein- und Großstädte so ähnlich sind. Am markantesten aber zeigt sich dieser Fokus an den Bodenpreisen. Baugrund und das Bauen haben sich in den letzten Jahrzehnten unter anderem so verteuert, weil Boden als ,Ware wie jede andere‘ angesehen und wie eine solche behandelt wird. Gerade auch wegen steigender Bodenpreise können Menschen am Ende durch Selbstbau proportional weniger einsparen als früher.
- Die Ansprüche an modernes Wohnen und damit an Baustoffe und -materialien haben sich verändert. Das macht Projekte des individuellen oder kollektiven Eigenbaus aufwändiger und komplexer. Fragen des Komforts und der binnen weniger Jahrzehnte verfestigten Gewohnheiten (wie praktisch ist doch Bauschaum!) spielen hier genauso eine Rolle wie der Wunsch, immer größere Wohnflächen zur Verfügung zu haben.[7]
- Die rechtlichen Bedingungen erfordern oft ein enormes Können, viel Zeit und hohe Investitionen, um letztlich die Zertifikate zu bekommen, die die Einhaltung der Mindeststandards bestätigen. Sie betreffen Fragen des Brandschutzes genauso wie die Statik, die Bauphysik, den Schallschutz oder die Energieeffizienz. Hinzu kommen die Standards, die eingeführt wurden, um die europäischen Energie- und Klimaziele zu erreichen. Sie gehen häufig mit technischen Ansprüchen wie luftdichten Gebäudehüllen, Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen oder der Verwendung von recyclebaren Baustoffen einher, was zunehmend (u. U. kostenträchtige) Fachexpertise erfordert.
Als wäre also „alternatives“ Bauen nicht herausfordernd genug, bestimmen Marktdominanz, ausdifferenzierte Ansprüche und weitreichende staatliche Auflagen, was jeweils möglich ist. Wenn wir das Bauen und Wohnen als Commoning verstehen, müssen wir damit umgehen. Um diesen Verständnisprozess zu unterstützen, können wir unser Augenmerk darauf richten, wie Wohnungen, Häuser, ja ganze Stadtteile gemeingeschaffen werden. Wir können zu diesem Zweck geduldig gelingende Commons-Praktiken untersuchen und herausarbeiten, was sie in und trotz ihrer Unterschiedlichkeit gemeinsam haben. Daraus schöpfen wir die Inspiration, die wir für zukunftsfähiges Bauen und Wohnen brauchen. Allgemeiner gesagt: Bei den Amischen, in den Bauwochen oder der Riglap-Kultur finden wir Elemente, die uns helfen, das Bauen neu zu denken. Hierbei ist die wichtigste Lektion zugleich die einfachste: Gemeinsam und selbstorganisiert zu bauen ist eine kulturübergreifende Selbstverständlichkeit, die im Prinzip allen ermöglicht, ein würdiges Dach über dem Kopf zu haben, ohne dass dies nur von der Verfügung über Geld und Fachwissen abhängt. Auf die Menschen selbst und die Qualität des Commoning kommt es an, also darauf, wie Menschen denken und handeln. Einige solcher Qualitäten benennen wir in den folgenden Abschnitten. Damit wollen wir zeigen, was es heißt, die Perspektive der Commons einzunehmen, in Commons-Kategorien zu denken und das, was wir tun und herstellen, als Commons zu begreifen. Es heißt nicht – soviel sei vorweggenommen –, dass alle alles teilen und gemeinsam machen müssen und dass kein Platz für Individualität ist. Im Gegenteil. Die Ergebnisse sind oft lebendiger, ,wärmer‘ und individueller.
4. ALLES KÖNNTE ANDERS SEIN
Dass sich vieles anders denken und gestalten lässt, können wir an Bauprojekten sehen, die keinen Kredit bei herkömmlichen Banken aufnehmen, nicht für alles (für manches schon!) Fachleute beauftragen und auch nicht alles in Marktpreisen kalkulieren. Solche Projekte zeigen, dass wir vieles von dem, was wir vermeintlich tun müssen, ganz anders tun können. Bei genauerer Betrachtung zeigen sich in ihnen Grundmuster, welche gut beschreiben, was es bedeutet, commonsmäßig zu bauen und zu wohnen. Wir skizzieren zunächst fünf solcher Grundmuster:
- Einbeziehend und kooperativ entscheiden
- Wissen und Know-how großzügig weitergeben
- Auftragsvergabe minimieren und selbst beitragen
- Direktkredite sammeln und Bankkredite scheuen
- Boden und Wohnraum dem Markt entziehen
Diese fünf Grundmuster sind wichtige, freilich nicht erschöpfende Qualitäten, um das Bauen und Wohnen als einen Prozess des Gemeinschaffens verstehen und leben zu können. Wenn wir diese fünf Grundmuster umsetzen, ändert sich vieles.
5. EINBEZIEHEND UND KOOPERATIV ENTSCHEIDEN
Die konkreten Formen kooperativen Handelns – vom Bauprozess bis zum Einzug und zum Wohnen – sind wesentlich davon abhängig, wie weit die Bauenden ein einbeziehendes Selbstverständnis haben und wie sie es realisieren. Wer und was wird alles einbezogen? Geht es nur um einen organisatorischen Rahmen für die billigere Realisierung von Einzelunterkünften (entsprechend der oben skizzierten bloßen Zweckgemeinschaft)? Oder werden die Bedürfnisse der jeweils anderen Beteiligten mitgedacht, um gemeinsame Formen der Umsetzung zu finden? Wer gehört zu den „anderen Beteiligten“ – sind auch die dabei, die keine Schaufel in die Hand nehmen können? Auch jene, die besondere bauliche Vorkehrungen brauchen, um dort zu wohnen? Jene, die aufgrund von Einschränkungen ihre Stimme gar nicht erst einbringen können? Gar jene, die noch gar nicht geboren sind oder als Geflüchtete später dazukommen werden?
Die Konstituierungsphase eines Projekts stellt die Weichen. Je klarer die verschiedenen Bedürfnisse sichtbar gemacht werden, je häufiger konfliktive Situationen schon zu Beginn beziehungswahrend (vgl. Helfrich/Bollier 2019: 108) durchlebt werden, kurz: Je intensiver das Commoning zu Beginn ist, desto stabiler die Vertrauensbasis für den Bauprozess und das spätere Zusammenwohnen. Vereinbarungen können hier ein wertvolles Instrument sein. In ihnen werden Ziele formuliert, Erfahrungen verdichtet, Regeln verabredet. Gleichzeitig sollen Vereinbarungen Luft zum Atmen geben, nicht alles lässt sich in Regeln gießen. Gute Vereinbarungen schaffen Vertrauen und machen Entscheidungen später leichter. Sie erlauben es, „sich auseinanderzusetzen, sich intensiv zu streiten, ohne das Ziel und das Projekt gleich infrage zu stellen“ (Knaffl 2009: 103).
In einbeziehenden Entscheidungsverfahren wird festgelegt, warum wer was erledigt, um Orientierung, Klarheit und Verlässlichkeit im Projektablauf zu gewährleisten. Manchmal geht es noch auf der Baustelle darum, zwischen mehreren Möglichkeiten abzuwägen. Hier die eigenen Wünsche in Entscheidungen einbezogen zu wissen, stärkt die Verbindung zum gemeinsamen Projekt. Doch wie funktionieren einbeziehende Entscheidungen?
Auf einer Skala der Entscheidungsbeteiligung, von Einzelherrschaft bis Alle-entscheiden-alles gibt es viele gangbare Wege. Gangbar im Sinne der Commons sind Wege, die einbeziehend und ressourcenschonend sind. Es gilt, so viel wie nötig und so wenig wie möglich Energie in die Entscheidungsverfahren zu geben, damit sie nicht zu viel Zeit und Kraft einnehmen und gleichzeitig breit getragen werden. Einbeziehend ist die Entscheidung, wenn dabei an die Bedürfnisse global aller Menschen gedacht wird. Einbeziehendes Entscheiden legt nahe, die Entscheidungsfindung methodisch kooperativ zu gestalten. Das heißt, dass während der Informations- und Vorschlagsphase der Entscheidungsfindung alle Beteiligten die Möglichkeit haben, sich gegenseitig zu hören und zu verständigen. Dafür stehen unterschiedliche Methoden zur Verfügung: vom offenen Gespräch ohne oder mit Moderation über Prozesse der Konsensfindung, des systemischen Konsensierens oder den Konsent mit soziokratischer Organisierung bis zur konvergenten Moderation. Hierbei werden „Geduld“ und „Sitzfleisch“ (ebd.) oft herausgefordert, denn einbeziehende Entscheidungsprozesse dauern meist länger als Entscheidungen in professionell-hierarchisch geführten Projekten. Dafür sind sie aber auch tragfähiger!
Bewährt haben sich Verfahren, die sich an der ,Do-ocracy‘ orientieren. Auf Basis intensiv erarbeiteter Vereinbarungen und grundsätzlicher Rahmen- und Richtungsfestlegungen entscheiden kleinere Fachgruppen oder auch Einzelpersonen eigenverantwortlich ,im Tun‘ über die jeweils konkreten Schritte. Diese werden transparent in die Gesamtgruppe rückvermittelt. In regelmäßigen Reflexionsrunden kann geprüft werden, ob sich weiterhin alle einbezogen fühlen oder Korrekturen angebracht sind. Gegenseitiges Vertrauen ist hierfür eine wesentliche Grundlage, das in dem Maße wächst, wie positive Erfahrungen gemacht werden.
6. WISSEN UND KNOW-HOW GROSSZÜGIG WEITERGEBEN
Wissen großzügig weitergeben bedeutet, alles Wissen, alle Inhalte, alle digitalen Werkzeuge, jegliches Design ,freizugeben‘ (Stichwort Open Source) und über das Internet global verfügbar zu machen. Der Designfokus liegt auf modularen, lokal anpassbaren Lösungen. In der Open-Source-Bauszene – vgl. Wikihouse, OSE Microhouse oder Open Source Building Institute (OBI)[8] – ist dies bereits Standard. Die Grundidee ist hier, dass das Fachwissen nicht ,verkauft‘, sondern in erster Linie zur Befähigung anderer eingesetzt wird. So wird das Bauen selbst als individueller und kollektiver Lernprozess gestaltbar, was zu einer radikal veränderten Rolle von Architekt*innen führt und das Wissen und Fabrikations-Know-how verallgemeinert. Know-how bedeutet hier ein praktisches Wissen-Wie, welches durch Erklären und Vormachen weitergegeben wird. So werden die großen formalen, ökologischen, technischen und finanziellen Entscheidungen nicht von einer* Architekt*in oder Bauleiter*in vorgegeben, sondern nur verantwortlich durch diese beraten. Im Selbstbau entscheiden die Beteiligten zusammen – bestenfalls gemeinstimmig (Helfrich/Bollier 2019: 129ff.) – und setzen ihre Vorhaben gemeinsam und bedürfnisorientiert um. Selbstbauende müssen oft tief in die jeweilige Materie einsteigen, sie lernen die Vorgänge zu verstehen und sich zu helfen. Sie werden zu mündigen Kritiker*innen des Bauprozesses. Das „Ding ist, es sich zu erarbeiten“, wie Beteiligte sagen (Knaffl 2009: 107). Dabei kann die Selbstlernkompetenz sowohl während der Bauvorbereitung mit dem Besorgen von Material, dem Engagieren von Fachleuten als auch bei den lernbegleitenden Aspekten des Lernwegs, Tempos und Transfers in die Praxis sehr hoch sein. Für Selbstbauende sind der „Wille dazu, sich Kompetenzen aneignen zu wollen“ und das Zutrauen, die eigenen Lernziele zu erreichen, sicherlich das Wesentliche (ebd.: 106). Besonders augenscheinlich sind die Kompetenzen, die sich Beteiligte beim Kommunizieren, rechtlichen und finanzplanerischen Vorgehen, Planen, Koordinieren, Organisieren und Handwerken aneignen (vgl. Knaffl 2009: 104ff).
Das wirkt in vielfältiger Weise positiv. In selbstorganisierten Bauprozessen eignen sich Menschen letztlich nicht nur fachliche, sondern auch emotionale, motivationale und soziale Kompetenzen an. Emotionale Kompetenz zeigt sich in der Selbstaufmerksamkeit, im Einfühlungsvermögen und der Fähigkeit, emotionalen Schaden wieder gutzumachen sowie am Umgang mit negativen Gefühlen (vgl. Steiner 1997: 36). Motivationale Kompetenz aufzubauen bedeutet, umgangssprachlich formuliert, „herauszufinden, welche Tätigkeiten einem liegen und solche Tätigkeiten in sein Handeln möglichst einzubringen“ (Knaffl 2009: 39). In bedürfnisorientierten Bauprozessen wird das ständig gefordert und dadurch gefördert. Wenn sich Beteiligte eines Bauprojekts in Tätigkeitslisten eintragen, ist es also von Vorteil, die eigenen Vorlieben zu kennen und zu berücksichtigen. Das muss nicht dazu führen, dass dann nur noch diese Tätigkeiten ausgeführt werden, denn auch die Wahl von neuen Aufgaben erhöht die diesbezügliche Selbstkenntnis und die Möglichkeit, Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen.
7. AUFTRAGSVERGABE MINIMIEREN UND EIGENE BEITRÄGE EINBRINGEN
Auftragsvergabe minimieren bedeutet, Lohnarbeit nur einzusetzen, wenn es unumgänglich ist. Das trägt dazu bei, die Kreditnotwendigkeiten und damit finanzielle Abhängigkeiten und -risiken zu senken und spricht neben dem ungeheuren Lern- und Selbstermächtigungsaspekt für das gemeinsame Selbermachen – das Do It Together (DIT), um möglichst viele verschiedene fachliche Qualifikationen in einem Projekt zusammenzubringen. Bedürfnisorientierter Selbstbau ist zudem Garant für eine besondere Beziehung zum Gebauten – Selbstgeschaffenes fühlt sich immer anders an. Allerdings verlangsamt sich durch Selbstbau auch der Bauvorgang selbst und Qualitätseinbußen sind möglich. Diese können hingenommen werden, wenn niedrigere Baukosten es auch weniger Finanzkräftigen ermöglichen, hochwertigen Wohnraum für sich zu schaffen.
Es geht allerdings bei diesem Grundmuster weder einfach noch nur darum, Lohnarbeit durch Eigenarbeit zu ersetzen. Das Anliegen ist zum einen, gute Bedingungen für weniger Lohnarbeitsabhängigkeit zu schaffen – die Coronakrise zeigt, wie notwendig dies gesamtgesellschaftlich ist. Commoning verträgt sich folglich sehr gut mit dem Ruf nach allgemeiner Verkürzung der Lohnarbeit, um mehr Zeit für Selbstsorge, gesellschaftlich relevante Arbeit und eben Commoning zu gewinnen. Die ganze Diskussion weist einen Weg zum Aufbau solidarischer Strukturen, die Kapazitäten und Ressourcen für den Selbstbau freimachen. Zum anderen besteht die Aufgabe auch darin, diese Eigenleistung commonsartig zu organisieren. Das kann bedeuten, dass die praktischen Baubeiträge nicht ,verrechnet‘ werden, sondern jede*r gibt, was sie/er geben kann, was alles andere als selbstverständlich ist. In der üblichen Waren- und Tauschlogik gedacht, sollen alle ,das Gleiche geben‘ – etwa durch Einrichtung von ,Zeitkonten über die geleistete Arbeit‘. Doch ,das Gleiche geben‘ bedeutet unter Berücksichtigung der Lebenswirklichkeiten der Einzelnen nicht für alle das Gleiche. Wer Kinder hat, verfügt über wesentlich weniger Zeitressourcen als etwa alleinstehende Personen, und auch die berufliche Eingebundenheit spielt eine Rolle, nicht zu reden vom Alter oder der individuell-körperlichen Leistungsfähigkeit. Hier funktioniert die Praxis der Beitragsrunden aus der Solidarischen Landwirtschaft[9] (geben, was jede*r geben kann) wesentlich besser, weil dadurch unterschiedliche Lebensumstände berücksichtigt werden.
8. DIREKTKREDITE SAMMELN UND BANKKREDITE SCHEUEN
Bankkredite scheuen bedeutet, so viel Unabhängigkeit wie möglich vom Markt und von institutionellen Kapitalgeber*innen zu sichern. Es ist eine wichtige Voraussetzung dafür, so entscheiden und handeln zu können, dass sich die Geldlogik nicht durchsetzt, selbst wenn das Prozesse verzögert. Auch wenn alle Beteiligten tatkräftig beitragen, muss oft ein großer Teil der Leistungen – etwa bestimmte Baustoffe und Tätigkeiten, die mit Gewährleistungspflichten verknüpft sind – über den Markt erworben werden. Die dafür nötige Finanzierung lässt sich mit Ausnahme des Sonderfalls, dass Geld – etwa aus hohen Erbschaften – vom Himmel fällt, in der Regel nicht ohne Kredite auf bringen. Allerdings gibt es auch hier commonsorientierte Handlungsmöglichkeiten und eine Fülle alternativer Finanzierungsformen. Selbstbauende sind dabei auf eine kluge Kombination derselben angewiesen: Eigene Beiträge, staatliche Förderungen, Crowdfunding-Kampagnen für Schenkgeld und (zinsfreie oder -arme) Kleinkredite aus privater Hand können zusammengenommen Bankkredite weitgehend ersetzen und helfen, die Abhängigkeit von Kapitalgeber*innen zu reduzieren. Zwar können auch Kleinkreditgeber*innen ihre Kredite zurückhaben wollen, etwa weil das so vereinbart wurde oder weil sie das Geld selbst benötigen, doch hier besteht die Möglichkeit, Kleinkredite durch neue Kleinkredite von anderen Personen abzulösen ohne die ,Kapitalsubstanz‘ anzutasten. Diese Kreditrotation hat den angenehmen Nebeneffekt der ,Kapitalneutralisierung‘, denn das im Projekt verbleibende Kapital ist nun der Markt- und Verwertungslogik entzogen und gleichsam wohltuend stillgestellt. Es kann nicht mehr genutzt werden, um es zu vermehren.
9. BODEN UND WOHNRAUM DEM MARKT ENTZIEHEN
Boden und Wohnraum dem Markt entziehen bedeutet, die Eigentumsverhältnisse so zu ändern, dass die Macht des Eigentums und des Kapitals langfristig neutralisiert wird, sodass aus dem Haben allein keine Entscheidungsmacht und kein Renteneinkommen entstehen. Um diese Idee umzusetzen, sind die konkreten rechtlichen Lösungen oft verschachtelter als die häufig diskutierte Überführung von Individual- in Kollektiveigentum, schließlich kann auch Letzteres durch einen Verkauf wieder an den Markt zurückfallen. Das Mietshäuser Syndikat (vgl. Horlitz in diesem Band) hat diese Problematik gut gelöst und damit die Eigentumslogik zurückgedrängt, die darin besteht, dass Eigentum Ausschluss erzeugt. Es ist ein Pfeiler einer strukturellen Logik, in der die Einen ihre Wünsche realisieren, in dem sie gleichzeitig und oft ungesehen anderen Möglichkeiten nehmen, dasselbe zu tun. Diese Logik der Exklusion finden wir auch beim Bauen und Wohnen, und sie gilt – in durchaus graduellen Abstufungen – für alle Eigentumsformen. Auch Kollektiveigentum hebt die exkludierende Wirkung von Eigentum nicht auf, kann sie aber – ähnlich wie der Gesetzgeber – beschränken und die kollektive Verfügung (mindestens partiell) in die Hände der Nutzer*innen legen.
Einige Beispiele: In Deutschland gibt es selbstverwaltete Baugruppen in verschiedenen Rechtsformen (Wohneigentümergemeinschaft oder GmbH). Sie ermöglichen gemeinschaftliche Prozesse beim Bodenerwerb, während des Bauens und in der Wohnumfeldgestaltung. Allerdings legt die individuelle Ausrichtung auf das ,Eigene‘ (Haus/Wohnung innerhalb des Gesamtprojekts) einem Commoning von vornherein enge Grenzen an. Im Konfliktfall heißt es schnell: „Das ist meins, hier entscheide ich“. Kleine Wohngenossenschaften bieten hier ein günstigeres Umfeld. Sie sind auf Selbstorganisation des kollektiven Eigentums ausgerichtet („Alles gehört allen, aber niemandem individuell“), das günstigere Bedingungen für Commoning schafft. Der Zweck ist jedoch, ausschließlich die eigenen Mitglieder mit Wohnraum zu versorgen. Das kann durchaus bornierte Haltungen hervorbringen, sich einmal mehr nur auf das ,Eigene‘ – das hier das ,Gemeinschaftliche‘ ist – zu begrenzen.[10] Zudem gibt es – auch bei hohen Beschlussquoren – keine Gewähr, dass kleine Genossenschaften sich nicht auflösen, um das gemeinschaftliche Eigentum zwecks individuellen Gewinns zu verkaufen (ganz zu schweigen von der politischen Zerschlagung von kommunalen Genossenschaften). Dies zu verhindern, ist Zweck der trickreichen Rechtskonstruktion des Miethäuser Syndikats. Zugleich schafft sie es, die vielfältigen Beziehungen, die vom ,Eigentum‘ betroffen sind – zu Menschen aus anderen Projekten, zu künftigen Generationen, zum Boden als Baugrund usw. – abzubilden (Helfrich/Bollier 2018: 236ff.). Der Netzwerkcharakter des Syndikats ermöglicht zudem projektübergreifende Formen der Solidarität und Finanzierung.
Alle vorgestellten Möglichkeiten, Boden und Wohnraum dem Markt und damit der Logik der Verwertung zu entziehen, haben ihre Grenzen. Eigentum zu vergemeinschaften birgt einen Selbstwiderspruch: Es ist der Versuch, gegen die ausschließende Logik des Eigentums mit den Mitteln des Eigentums vorzugehen. Wer drinnen ist, kann an den Früchten des Projekts teilhaben, schließt jedoch gleichzeitig jene aus, die außen vor bleiben. Dieser Widerspruch lässt sich nur aufheben, wenn das Außen keiner anderen Logik mehr unterworfen ist wie das Innen. Das verweist damit auf eine gesellschaftliche Perspektive, in der sich niemand mehr auf Kosten anderer behaupten muss, um die eigenen (Wohn- und andere) Bedürfnisse zu befriedigen (vgl. Sutterlütti/Meretz 2018).
10. WAS COMMONING EINFACHER MACHT: VERFÜGEN, VEREINBAREN, KÖNNEN
Alle im Bereich des selbstorganisierten Bauens und Wohnens wissen: Commoning gelingt nicht immer. Es gibt günstigere und ungünstigere Bedingungen. Zu den ungünstigen Bedingungen gehört das zunehmende Zur-Ware-Werden und die Verteuerung von Baugrund und Baupraxis. In unserem Beitrag zeigen wir Wege, diesen Warenfokus zu überschreiten und durch einen Commonsfokus zu ersetzen. Es sind Wege, die darauf verweisen, wie bedürfnisorientiertes und weitgehend selbstorganisiertes Bauen auch unter ungünstigen Bedingungen gelingen kann. Zugleich entstehen durch die Entfaltung der fünf beschriebenen Grundmuster neue Bedingungen, Commoning einfacher zu machen; etwa das dauerhafte und rechtssichere Verfügen über Grundstück und Gebäude, genauso wie die Verfügung über Geld, Material und Zeit. Wichtig ist zudem, einbeziehende Vereinbarungen immer wieder neu zu finden oder anzupassen und dafür zu sorgen, dass diese Aufgabe zum selbstverständlichen Arbeitsstil und nicht als Extra-Belastung empfunden wird.
Und schließlich erleichtert die gekonnte Erledigung anfallender Aufgaben das selbstorganisierte, bedürfnisorientierte Bauen ungemein. Können bezeichnet den Fähigkeitsgrad, eine Aufgabe zu erledigen. Es variiert kaum greifbar zwischen den Beteiligten, entwickelt sich ständig weiter und wächst mit der Erfahrung. Für ein gelingendes Projekt muss am Ende die Summe der notwendigen Aufgaben erledigt worden sein. Die Besonderheit ist nun, dass das dafür zugehörige individuelle oder kollektive Können objektiv schwer einschätzbar ist. Subjektiv sind die Beteiligten allerdings recht gut in der Lage, die (Lern-)Fähigkeiten ihrer Mitstreitenden einzuschätzen. Solche subjektiven Einschätzungen prägen die Kooperationsbereitschaft hinsichtlich Art und Ausmaß des Engagements sowie der Auswahl von Mitbauenden für bestimmte Aufgaben. Ob eine Person eine Aufgabe angehen will, wird demnach vom Vertrauen der Anderen in ihr Können mitentschieden. Je mehr Vertrauen es gibt, desto leichter entscheidet sie sich für eine Aufgabe. Können ist – und auch das ist anders als in marktvermittelten Bauprozessen – keine notwendige Bedingung, die vor der Bauausführung erfüllt sein muss, denn commonsorientiertes Bauen ermöglicht Lernprozesse auch unterwegs – im Tun.
11. FAZIT
Wir haben versucht zu zeigen, dass Wohnen und Bauen – so wie andere Prozesse auch – anders gedacht und gemacht werden können: als Commons und Commoning statt als Dienstleistung oder gutgemeinte Gemeinschaftsaktion. Das Bauen und Wohnen als Commons zu denken, bereitet den Weg dafür, es mehr als Commoning zu praktizieren. Beides zusammen zieht neue Leitplanken ein, schafft andere Wohnräume, Häuser und Stadtteile sowie andere Bauweisen und andere Formen des Miteinanders – und verweist schließlich auf andere gesellschaftliche Verhältnisse jenseits von Markt und Staat.
Der Gestaltungsprozess selbst realisiert sich so, dass alle relevanten Bereiche, Beziehungen und Modi eines Bauprozesses oder Wohnprojekts aus Commons-Perspektive durchdacht und, wenn möglich, ausgerichtet werden. Was dies bedeuten kann, haben wir am Beispiel von fünf Grundmustern beschrieben. Sie sind nicht als Handlungsvorschrift zu verstehen, bieten aber eine Orientierung, wie wir Commoning-Qualitäten in der Praxis verankern können. Wenn beim Bauen auf die Anwendung dieser Grundmuster geachtet wird, ändert sich das Bauen selbst.
Deshalb ist die Qualität des Commoning entscheidend. Commoning braucht Gemeinschaft, aber Gemeinschaften sind oft Zweckgemeinschaften und diese führen nicht automatisch zum Commoning – so wie kollektives Eigentum nicht Garant dafür ist, dass Land oder Wohnraum dem Markt entzogen wird. Der Begriff begnügt sich nicht mit einem Verweis auf das Gemeineigentum, so wenig wie er gemeinschaftliches Handeln romantisiert. Er fasst vielmehr die Beziehungs- und (Re-)Produktionsweisen zusammen, die uns helfen, unsere Welt als Gemeinsames zu verstehen und zu gestalten. Diese Reflexionen dienen dazu, das, was die Amischen und Adis ,halt so machen‘, was ihnen noch als Selbstverständlichkeit gilt (beitragen, konviviale Techniken nutzen, sich gegenseitig Häuser bauen, super und effizient in Sachen Selbstbau sein) als Inspiration zu nutzen und zugleich ‚auf eine andere Stufe‘ zu heben. Denn die Schwierigkeit liegt ja darin, dass wir eine andere Bau- und Wohnkultur haben. Wir müssen also da durch – und das Bauen wieder anders denken lernen. Wenn es uns in diesem Prozess gelingt, wo immer möglich Rollen zu verändern, Finanzierungen umzubauen, unsere Selbstbaufähigkeiten zu trainieren, andere Wohnformen zu pflegen und Boden dem Markt zu entziehen – dann entziehen wir dem kapitalistischen Bauen und nicht-nachhaltigen Wohnen unsere Energie. Darin liegt die Kraft der Commons.
[1] https://www.youtube.com/watch?v=AsTB0HnM6WM.
[2] Die täuferisch-protestantische Glaubensgemeinschaft der (traditionellen) Amische führt ein stark in der Landwirtschaft verwurzeltes Leben und übernimmt neue Technologien nur nach sorgfältiger Prüfung ihrer Auswirkungen auf das Leben in der Gemeinschaft. Dieses findet weitgehend abgeschieden von der Außenwelt statt und ist klar vorgegebenen Geschlechterrollen verhaftet.
[3] https://www.wiwo.de/politik/ausland/krankenhaus-in-wuhan-ein-krankenhaus-im-eilverfahren-gegen-das-virus-und-fuer-pekings-image/25502432.html.
[4] https://amisch.de/amisch/?thread/1066-in-dieser-welt-aber-nicht-von-dieser-welt-zu-sein/.
[5] Ein Begriff von Ivan Illich, etwa: lebensdienliche Techniken.
[6] Eine gute Einführung in verschiedene Commons-Ansätze und Abgrenzung zu anderen Begriffen findet sich auf der Seite des Commons Institut e. V. https://commons-institut.org/2020/wikipedia-commons.
[7] Die Durchschnittswohnflächen pro Person nehmen kontinuierlich zu und erreichten in Deutschland 2018 fast 47 m² im Vergleich zu 35 m² noch 1990. https://www.deutschlandinzahlen.de/tab/deutschland/infrastruktur/gebaeude-und-wohnen/wohnflaeche-je-einwohner In Österreich stieg die Durchschnittswohnfläche pro Person von 2009 von 42,9 m² bis 2019 gleichmäßig auf 45,3 m². https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/wohnen/wohnsituation/081235.html.
[8] https://www.wikihouse.cc/, https://www.opensourceecology.org/portfolio/microhouse/, https://www.openbuildinginstitute.org/about-what-we-do/. Siehe auch die Open Source Architecture License: https://wiki.p2pfoundation.net/Open_Source_Architecture_License.
[9] https://www.solidarische-landwirtschaft.org/fileadmin/media/solidarische-landwirtschaft.org/Mediathek/Aufbau-Solawi/Netzwerk-Solawi-Bieterrunde.pdf.
[10] So zeigt sich auch bei selbstorganisierten Genossenschaften die Tendenz, sich mit dem zu bescheiden, was sie einmal ,für sich‘ geschaffen haben.
QUELLEN
Helfrich, Silke; Bollier, David 2019: Frei, Fair und Lebendig. Die Macht der Commons. Bielefeld: transcript Verlag.
Kanning, Uwe Peter 2002: Soziale Kompetenz – Definition, Strukturen und Prozesse. In: Zeitschrift für Psychologie (210/4). Göttingen: Hogrefe.
Knaffl, Tomislav 2009: Kompetenzen im Selbstorganisierten Gruppenselbstbau am Beispiel dreier Projekte in Stuttgart. Unveröffentlichte Diplomarbeit. Stuttgart: Universität Stuttgart.
Marx, Karl 1974: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Rohentwurf 1857–1858. Berlin: Dietz.
Mibang, Tabang 2018: Collective Action and Community Labour Management System among the Adis of Arunachal Pradesh. In: International Journal of Management Studies ISSN (Print) 2249-0302 ISSN 2231–2528. http://researchersworld.com/ijms/vol5/issue3_3/Paper_04.pdf.
Steiner, Claude 1997: Emotionale Kompetenz. München: Hanser.
Sutterlütti, Simon; Meretz, Stefan 2018: Kapitalismus aufheben. Eine Einladung, über Utopie und Transformation neu nachzudenken. Hamburg: VSA.
SILKE HELFRICH
Silke Helfrich widmet sich forschend, vernetzend und beratend dem Thema Commons. Sie lebt in einem Haus mit fast 600-jähriger Geschichte und pflegt dort das bauliche Erbe vieler Generationen in traditioneller Weise. Die Mitgründerin des Commons-Instituts und der Commons Strategies Group ist auch international tätig.
TOMISLAV KNAFFL
Tomislav Knaffl hat in Stuttgart Architektur studiert und seine Abschlussarbeit über Kompetenzen im selbstorganisierten Gruppenselbstbau verfasst. Er ist im Projekt teilbar in Stuttgart und im Commons-Institut aktiv.
STEFAN MERETZ
Stefan Meretz lebt in einem Mehrgenerationenwohnprojekt in Bonn. Er ist Gründungsmitglied des Commons-Instituts, arbeitet im Forschungsprojekt „Die Gesellschaft nach dem Geld“, hat das Buch „Kapitalismus aufheben“ mitverfasst und bloggt auf keimform.de.